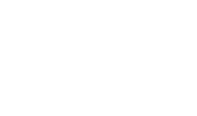Landnutzung im internationalen Kontext

Das integrierte Nebenfach (iNF) Landnutzung im internationalen Kontext beschäftigt sich mit ökologischen, technischen und sozioökonomischen Aspekten der Landnutzung auf internationaler Ebene. In besonderen Maßen werden die globalen ökologischen, ökonomischen und politischen Herausforderungen dargestellt, wie sie sich insbesondere durch Klimaveränderungen und als Folge einer ökonomischen Globalisierung ergeben. Dies geschieht schwerpunktmäßig am Beispiel „Wald“, jedoch werden auch benachbarte Disziplinen wie Land- und Wasserwirtschaft berührt.
Ein geographischer Schwerpunkt liegt dabei sowohl auf den waldreichen Regionen der Tropen und Subtropen, wie auch den großen, teilweise noch unerschlossenen Waldregionen Sibiriens oder Kanadas. Die ökologischen, technischen und politischen Lehrinhalte werden in der Beschäftigung mit den Zusammenhängen zwischen Landnutzung und ländlicher Entwicklung zusammengeführt.

Gesamtstudienverlauf B.Sc. Waldwissenschaften mit iNF Landnutzung im internationalen Kontext
Nebenfachleitung
Prof. Dr. Jürgen Bauhus
E-Mail: Juergen.Bauhus[at]waldbau.uni-freiburg.de
Modulinhalte
Betriebliches Management und Projekte
- Management und Organisation
- Operatives und strategisches Management Risikomanagement
- Allgemeines betriebliches Informationssystem (u. a. Kameralistik, doppelte Buchführung);
- Managementzyklus (mit Planung, Organisation, Personal, Kontrolle und Controlling)
- Nachhaltigkeitsmanagement
- Nationale - Internationale Fallstudien zu betrieblichem Management
- Fallstudien zu besonderen nationalen und internationalen betrieblichen Managementproblemen
Ökosysteme der Erde
In diesem Modul soll ein Überblick über die Vegetation und Ökologie der terrestrischen Lebensräume der Erde gegeben werden. Im Mittelpunkt des Moduls stehen neben der Charakterisierung der Vegetation der Biome der Erde das Kennenlernen der für die verschiedenen Biome prägenden Standortfaktoren. Dabei stehen das Klima und der Boden im Mittelpunkt, auch anthropogene Einflüsse werden besprochen. Zum Klima wird auf die Bedeutung der thermischen und hygrischen Zonierung der Erde für die Vegetationsverteilung eingegangen.
Zum Boden wird eine Einführung in die internationale Bodenklassifikation („World Reference Base for Soil Resources“, WRB) gegeben. Die Böden der Erde einschließlich ihrer Entstehung, ihrer Eigenschaften und auch ihrer Gefährdungen werden für die klimatisch-geologischen Großregionen der Erde besprochen. Dabei geht es auch um ökosystemare Kreisläufe von Energie, Wasser, Kohlenstoff und Nährstoffen. Von den Polarregion bis zu den Tropen werden alle wichtigen Großregionen der Erde behandelt.
Landnutzer und Landnutzungen in ländlichen Entwicklungskontexten
Dieses Modul führt die Studierenden ein in die sozio-ökologische Vielfalt der Landnutzungen in verschiedenen Regionen dieser Welt. Dies beinhaltet zum einen typische Landschaftskontexte und Dynamiken und zum anderen die jeweils relevanten Landnutzerinnen und Landnutzer, dessen Interessen und Kapazitäten zur Land- und Waldbewirtschaftung von zentraler Bedeutung sind.
Die verschiedenen Vorlesungsblöcke innerhalb dieses Modules beinhalten spezifische wichtige Nutzungs- und Fallbeispiele, mit denen die jeweiligen Dozent*innen langjährige Erfahrung gemacht haben. Im Vordergrund stehen ländliche Kontexte in den Tropen und Subtropen, aber auch andere Regionen werden vereinzelt erleuchtet.
Die Vorlesungsblöcke beinhalten folgende Themen:
- Nachhaltige Waldbewirtschaftung in den Tropen
- Plantagenwirtschaft
- Agroforstwirtschaft
- Kommunalwälder
- Restaurierung von Privatgrundstücken
- Baumsavannen und Urban Forestry
Es werden die ökologischen, sozialen, ökonomischen und technischen Dimensionen der jeweiligen Systeme näher erläutert. Des weiteren wird Bezug genommen auf den Beitrag verschiedener Systeme zu globalen Herausforderungen wie der nachhaltigen Bereitstellung von Rohstoffen, Mitigation und Anpassung an den Klimawandel, Bekämpfung des Biodiversitätsverlustes sowie der Armut durch ländliche Entwicklung.
Begleitet werden die Vorlesungen von kleineren Gruppenarbeiten sowie einigen Gastreferaten. Die Studierenden sollen dadurch in die Lage versetzt werden, Land- und Waldnutzungsoptionen aus unterschiedlichen Perspektiven, insbesondere der von ursprünglichen lokalen Ressourcennutzer*innen, zu verstehen und zu diskutieren.
Geographien von Entwicklung
Das Modul vermittelt einen Überblick über Grundbegriffe, zentrale Themenfelder und theoretische Konzepte der geographischen Entwicklungsforschung und verwandter Inhalte. Ausgewählte Fragestellungen werden exemplarisch vertieft, um interdisziplinäre Zusammenhänge aufzuzeigen und einen Einblick in aktuelle Forschungsarbeiten zu ermöglichen.
Schwerpunkte der Veranstaltung liegen auf aktuellen Theorien und Konzepten der geographischen Entwicklungsforschung und der Analyse des Wechselverhältnisses zwischen globalen Wirtschaftsbeziehungen und lokalen Entwicklungsprozessen.
Im vorlesungsbegleitenden Tutorium haben die Studierenden die Gelegenheit, in Anknüpfung an die Inhalte der Vorlesung aktuelle empirische Forschungsfelder zu identifizieren und anhand von Literatur- und Materialrecherchen zu bearbeiten.
Globale Politik der Nutzung natürlicher Ressourcen
Das Modul setzt sich mit der Steuerung globaler Nachhaltigkeitsprobleme in der Nutzung natürlicher Ressourcen (Entwaldung, Walddegradierung, Biodiversitätsverlust, Klimawandel) durch internationale Politik und Märkte in der globalen Wirtschaft auseinander.
Der Schwerpunkt liegt dabei zum einen auf den Grundlagen internationaler Politik: es werden zentrale Grundbegriffe (staatliche und private Akteure und Institutionen, Interessen, Werte, Regeln, Macht, Politikwandel, rechtliche Verbindlichkeit) vorgestellt, internationale Politikprozesse klassifiziert und Unterschiede und Verbindungen zur nationalen Politik diskutiert.
Dabei werden das „internationale Waldregime“ (Diskussionen über eine globale Waldkonvention; UN-Waldforum) und weitere internationale Politiken wie z.B. die UN-Nachhaltigkeitsagenda (SDGs), die UN-Biodiversitätskonvention (CBD), die UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC/REDD+), Handelsabkommen (ITTO, FLEGT, CITES) und ihre Wirkungen auf Wald, Umwelt und Wirtschaft vorgestellt und diskutiert.
Zum anderen stehen der Außenhandel mit (Holz- und Agrar-)Produkten und die Steuerung von nachhaltigen Lieferketten in der globalen Wirtschaft über Marktmechanismen und handelspolitische Instrumente im Vordergrund. Der Fokus wird dabei u.a. auf Phänomene der Globalisierung von Märkten der Forst-, Holz- und Agrarwirtschaft mit ihren Trends und Wirkungen gerichtet sowie auf Probleme des internationalen Handels mit illegalem Holz. Private marktbasierte Steuerungsansätze, wie z.B. Zertifizierung von Holz-, Palmöl- und Sojalieferketten, werden ebenso vorgestellt und diskutiert.
Fallstudie Landnutzungskonflikte
Land wird zunehmend zur knappen Ressource. Konflikte zwischen verschiedenen Landnutzungsformen und Landnutzern sind daher im internationalen Kontext typische Szenarien.
In diesem Modul sollen anhand eines Fallbeispiels Kompetenzen zur Analyse und Unterstützung von Lösungen solcher Landnutzungskonflikte auf der Basis von Realdaten erarbeitet werden. Dies beginnt mit der Identifikation und Typisierung von Konflikten, sowie einer Politikanalyse, in der Akteure, ihre Interessen und Koalitionen sowie die institutionellen Rahmenbedingen identifiziert werden.